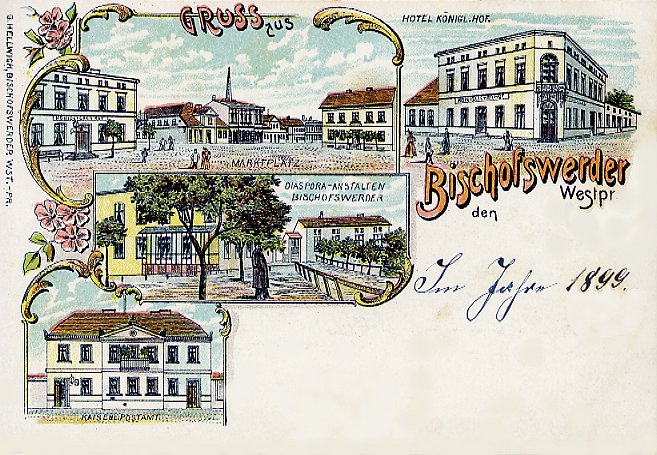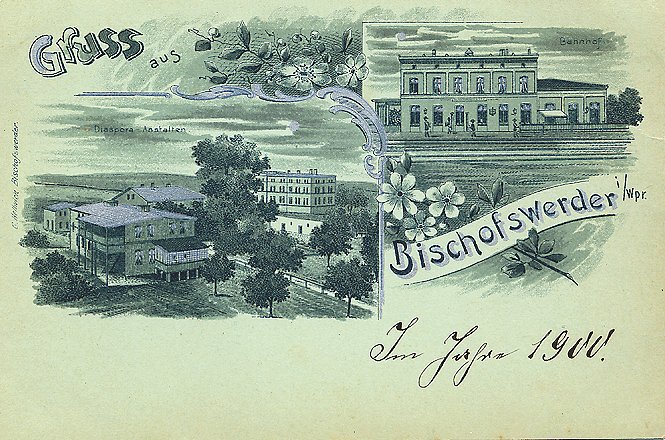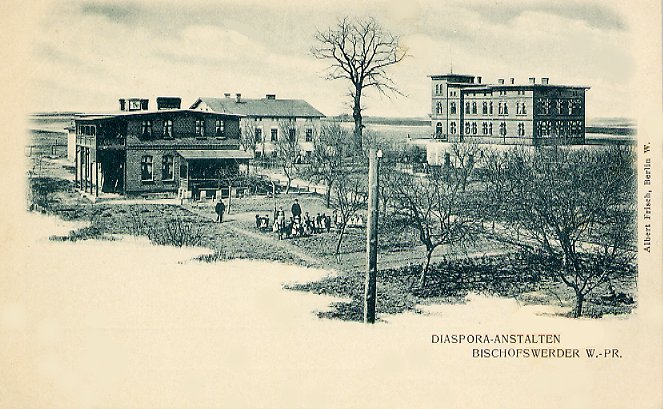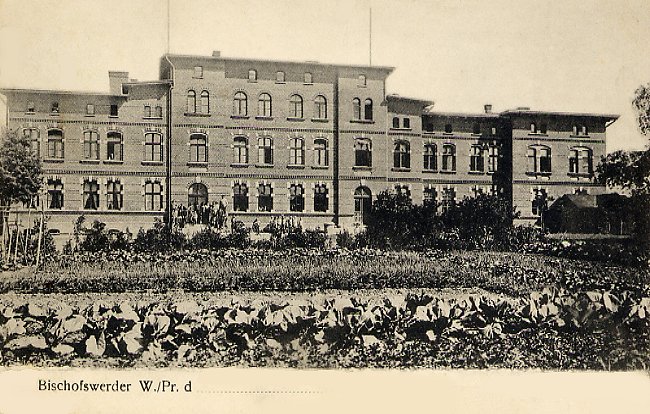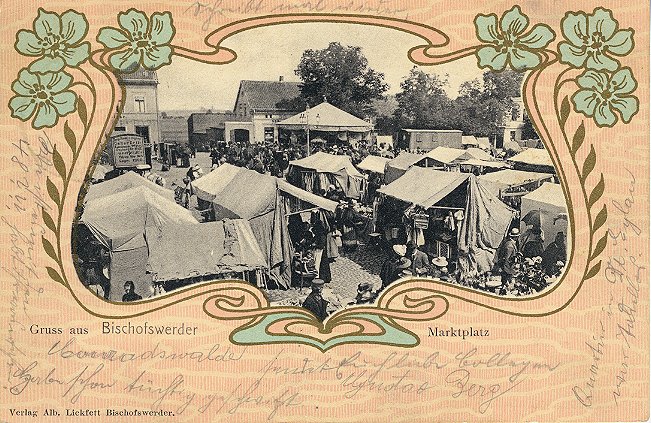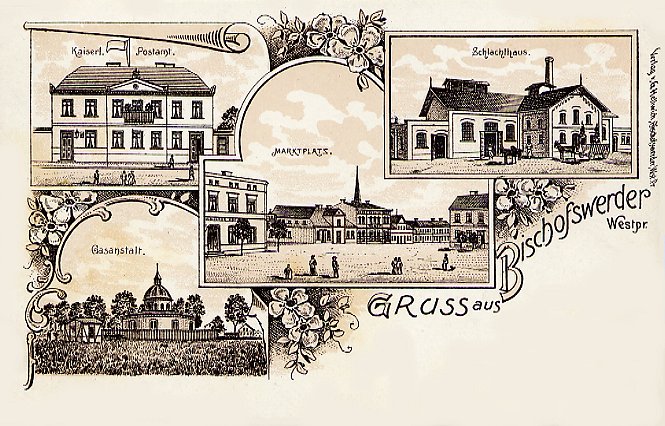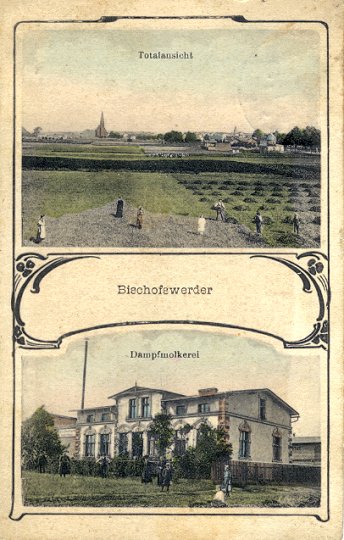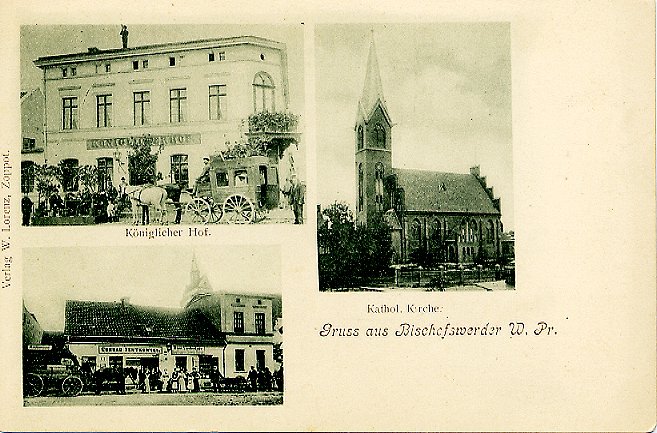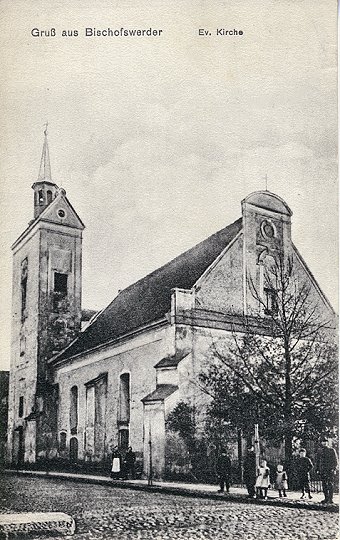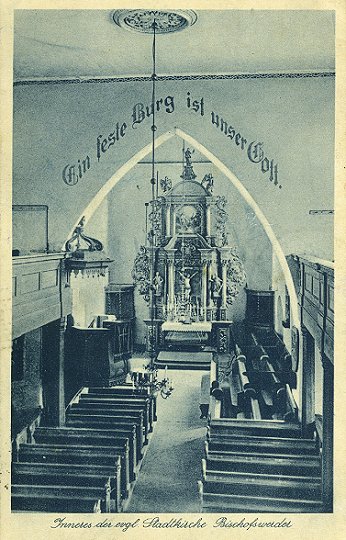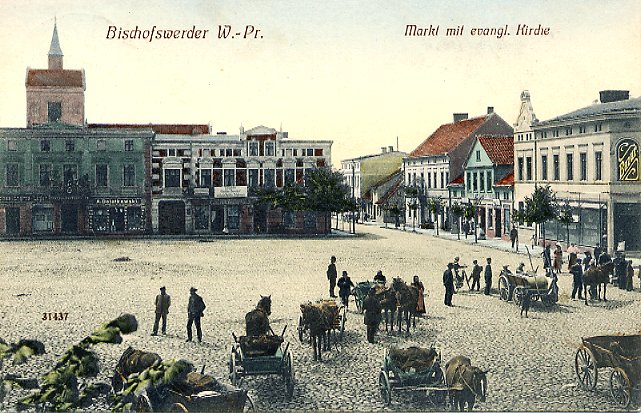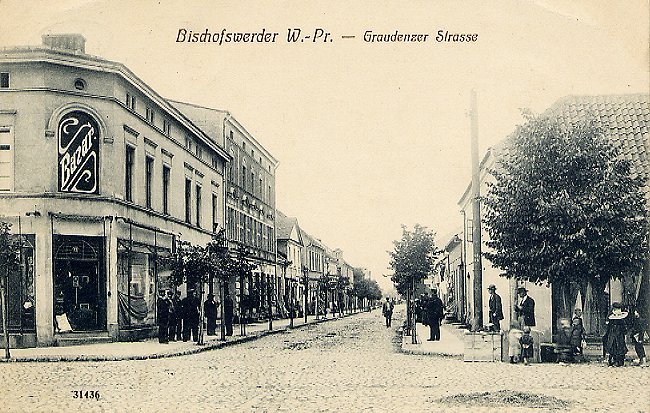|
Bischofswerder / Biskupiec Pomorski - Teil 1

1.
Das Wappen der Stadt Bischofswerder
An
einem bequemen Übergang des Flusses "Ossa", der Pomesanien
vom Kulmerland trennt, gründete Bischof Rudolf 1325 die Stadt, von dem
sie ihren deutschen Namen Bischofswerder (Bischofsholm) erhielt. Ihre
städtebaulichen Anlagen waren - ähnlich wie in Riesenburg (Prabuty),
Rosenberg (Susz) oder Deutsch-Eylau (Ilawa) - regelmäßig. Die
Kirche, ähnlich wie in Riesenburg und Deutsch-Eylau, war im
südöstlichen Teil gebaut. Bischofswerder besaß einst ein Bischofsschloss. Die Wehrmauern der Stadt hatten drei Einfallstore: das
Riesenburger (auch Freystädter oder Peterwitzer Tor genannt) sowie das
Lippinker und das Stangenwalder Tor. Der Bischofswerderer Markt
hatte eine rechteckige Form (80 x 60 m). Auf dem Markt stand das
Rathaus, das 1870 abgebrochen wurde. Erst 1927 wurde am Markt ein neues
Rathaus gebaut, das durch die Kriegshandlungen im Jahre 1945 beschädigt
wurde.
Bohle, Hans-Joachim: Das Kleine Reise-Lexikon für den
ehem. Kreis Rosenberg/Wpr., hrsg. von K.-H. Damrow, Düsseldorf
1997, S. 9.
Lossmann, Maria: "Ilawa" (aus dem Poln.
übersetzt von Hans-Joachim Bohle), im Heimat-Kurier, Heimatzeitung für
den ehem. Kreis Rosenberg/Wpr., hrsg. von Karl-Heinz Damrow, Kaarst:
Mai/Juni 1990, S. 36.
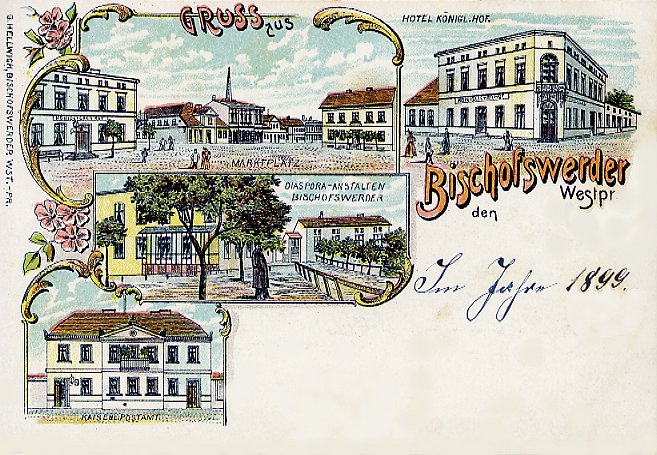
2. Lithographie
von Bischofswerder aus dem Jahr 1899.
Links
unten sieht man das Kaiserliche Postamt, darüber die Diaspora-Anstalten
und links oben den Marktplatz. Rechts oben ist das Hotel Königlicher
Hof abgebildet.

3. Diese Jugendstilkarte von Bischofswerder ist aus der Zeit
um 1900
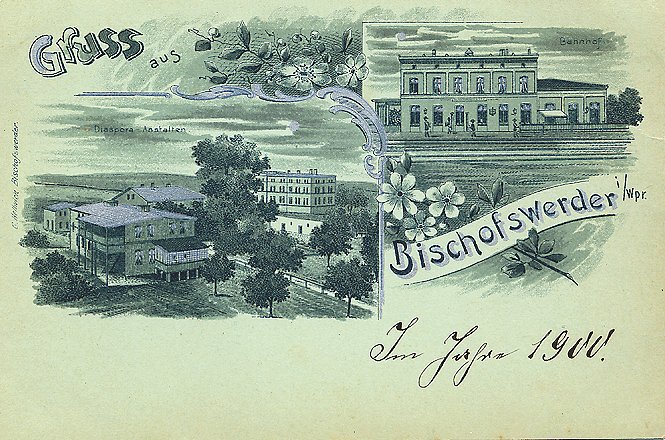
4. Lithographie mit Silberauflage ist aus dem Jahre 1900
Links
sieht man die Diaspora-Anstalten, und rechts den Bahnhof.
Barmherzige
Nächstenliebe hat in Bischofswerder eine Reihe von sozialen
Einrichtungen geschaffen. Es sind dies das Krankenhaus, das Siechenheim,
die Kleinkinderschule, das Waisenhaus und das Altersheim. Betreut wurden
diese am 18.11.1895 gegründeten Anstalten von Diakonissen des
Mutterhauses Danzig. Viele kranke Menschen aus ganz West- und
Ostpreußen fanden in den Diaspora - Anstalten Unterkunft, deren
1. Vorsitzender der Major a. D. und Rittergutsbesitzer von
Beneckendorff und von Hindenburg auf Neudeck war.
Neise, Erna: Bilder aus dem Kreis Rosenberg/Westpreußen, Leer:
Gerhard Rautenberg-Verlag 1989, viele Abb., 128 Seiten, Text S. 4.
Bahr, Ernst: Bischofswerder zwischen 1726 und 1939, Westpreußen -
Jahrbuch, Band 18, hrsg. von der Landsmannschaft Westpreußen, Münster:
Verlag C.F. Fahle 1968, 159 Seiten, S. 110, 111.
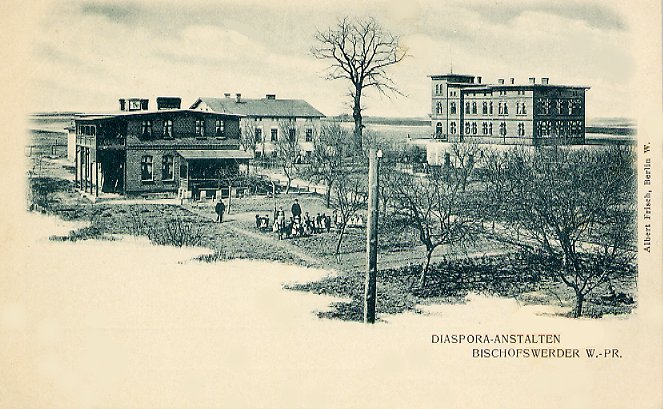
5. Die Diaspora-Anstalten von Bischofswerder
vor 1905 Ein ehemaliger Waisenjunge aus dem Heim erinnert
sich:
"Oberschwester Elise Krüger, unser "Mutterchen", war
die Leiterin der Diaspora-Anstalten. Sie war ein Engel für viele, die
niemand mehr haben wollte. Sie wurde im Jahre 1896 in Langfuhr-Danzig
geboren und gehörte später dem Danziger Diakonissenhaus an. Ich selbst
kam 1914 im Alter von nur drei Monaten als erster Säugling und Vollwaise
in die Diaspora-Anstalten unter die persönliche Fürsorge von
"Mutterchen", wie die Oberschwester liebevoll genannt wurde. Sie
vermittelte mir im Laufe der Jahre eine strenge, jedoch liebevolle
Erziehung. Die Betreuung der ihr anvertrauten Menschen, die Ärmsten der
Armen, alt und krank, war ihr Lebenswerk. In ihrer Gegenwart gab es keine
Hoffnungslosigkeit.
Sie war so vielseitig. Während des Ersten Weltkrieges hat sie im Heim
verwundete Soldaten gepflegt. Als von Bischofswerder nach 1918 weder Bahn-
noch Busverbindung nach dem Kreiskrankenhaus in Rosenberg bestand, ist
Mutterchen oft selbst mit dem Pferdewagen mitgefahren, um einen
Schwerkranken aus dem Heim oder aus der Stadt Bischofswerder auf dem
Transport zu betreuen, wenn auf dem langen, holprigen Weg Hilfe geleistet
werden musste. Zur Zeit der Inflation, wo ein Wäschekorb voll mit
Geldscheinen von einem Tag zum anderen keinen Wert mehr hatte, ging
Mutterchen mit dem Handwagen und uns Kindern zu den Bauern im Umkreis
betteln, um ein paar Kartoffeln, etwas Mehl, oder was es auch immer
einbrachte, zu bekommen, nur um den ihr anvertrauten Seelen
(durchschnittlich 120 bis 140) wenigstens eine warme Mahlzeit am Tage
reichen zu können. Wenn in der Kirche der Pfarrer durch Krankheit
ausfiel, war es Mutterchen, die den Gottesdienst abhielt. Wenn der
Organist nicht zur Stelle sein konnte, spielte Mutterchen die Orgel. Im
Heim kam es vor, dass bei der Beerdigung eines Heiminsassen der Pfarrer
nicht zur Verfügung stand. Mutterchen wusste auch hier Rat und Hilfe und
hat so manches Mal eine ergreifende Grabrede gehalten. Sie war so voll
Liebe für ihren Nächsten, dass es wahrhaftig keine Übertreibung ist,
wenn man sie als "Engel der Vergessenen" sah. Nach kurzer
schwerer Krankheit verstarb Oberschwester Elise Krüger im Dezember 1941,
im Alter von 72 Jahren, inmitten ihres Wirkungskreises. Möge ihr Andenken
in Ehren bleiben".
Läufer, Albert: "In Memoriam - Zum
Andenken an Oberschwester Elise Krüger" im Heimat-Kurier,
Heimatzeitung für den ehemaligen Kr. Rosenberg/Wpr., Hannover:
Damrow-Verlag GBR, Jan./Febr. 1985, S. 66-68.
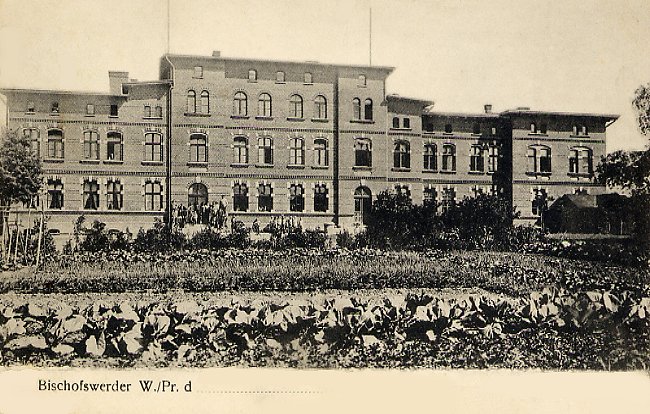
6.
Bischofswerder - das sog.
Krüppelheim, Diaspora-Anstalten (9.9.1911).
Heute sind darin Altenwohnungen
untergebracht.

7. Die Bewohner der Diaspora-Anstalten (1915)
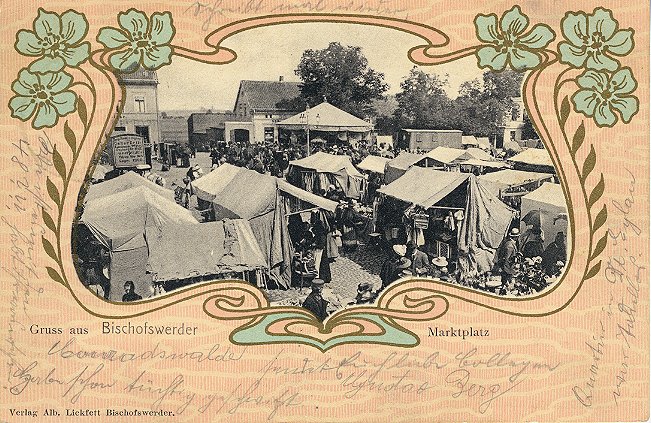
8. Jugendstilkarte von 1904 mit
einem bunten Jahrmarkttreiben auf dem Marktplatz
Eine unvergleichliche Kraft entfaltete die Stadt aber erst
nach 1772, als sie nicht mehr Grenzstadt war. Neben den Ackerbürgern
siedelten sich immer mehr Kaufleute, Handwerker und Gewerbetreibende an.
Bald war Bischofswerder einer der bedeutendsten Märkte West- und Ostpreußens.
So konnte der ein Hektar große Marktplatz die Zahl der Händler und
Schausteller an Pferde-, Vieh- und Krammärkten bald nicht mehr fassen.
Die Verkaufsstände mussten deshalb in die Nebenstraßen, die
Schausteller mit ihren Luftschaukeln und Karussells auf den Ossawiesen
untergebracht werden. Bis weit in die Kreise Löbau und Graudenz hinein
ging das Wirtschaftsgebiet. So war der Stadt bis zum Ausgang des 1.
Weltkrieges eine lange und schöne Blütezeit beschieden und vergessen
waren die harten Schicksalsschläge früherer Zeiten.
Müsse, Alfred: "Geschichte der Stadt Bischofswerder" in
"Der Kreis Rosenberg - Ein westpreußisches Heimatbuch."
Detmold: Verlag Hermann Bösmann 1963, viele Abb., 632 Seiten, Text S. 165
+ 166.
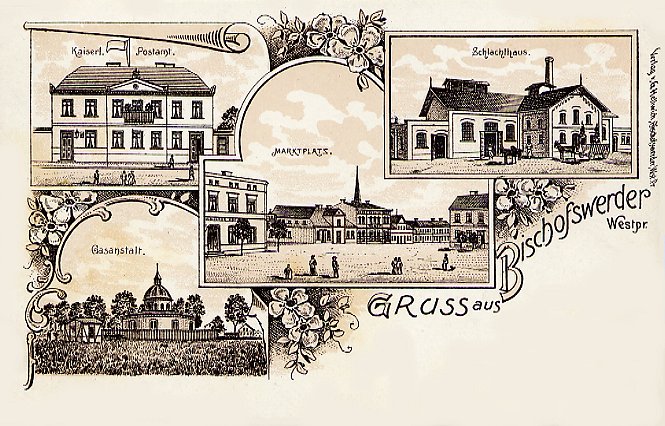
9. Diese Lithographie von Bischofswerder ist ebenfalls aus der
Zeit vor 1905.
Links
unten sieht man die Gasanstalt und darüber die Kaiserliche Post.
In der Mitte ist der Marktplatz abgebildet und rechts das Schlachthaus. 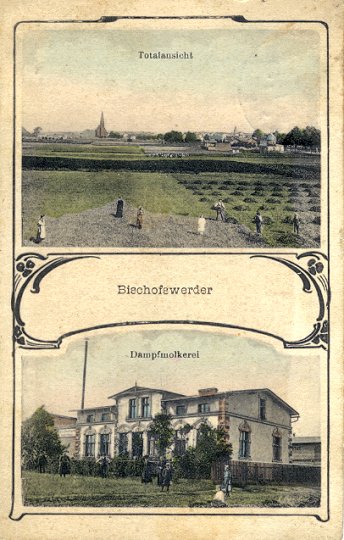
10.
Oben
sind Bauern bei der Heuernte zu sehen und unten die Dampfmolkerei (1909)
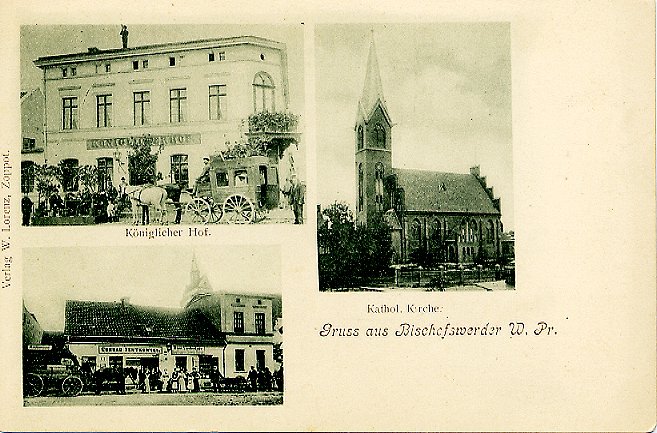
11. Diese 3-teilige Karte von Bischofswerder ist aus der Zeit vor
1905, als noch mit Pferden bespannte Postkutschen fuhren, die die
Gäste zum Königlichen Hof brachten (links oben). Links unten sieht man
den Laden von Conrad Sentkowski und daneben eine Bierniederlage.
Auf der
rechten Abbildung ist die 1893 erbaute katholische St. Johann Nepomuk- Kirche
zu erkennen.
Dekan Hoppenheit war dort viele Jahre als Seelsorger tätig. Reinhold Salzwedel, geb.
6.1.1898, gest. 1.5.1951 in Bischofswerder, war letzter deutscher Pfarrer
an dieser Kirche. Er wurde an der äußeren Chorseite seiner Kirche zur
letzten Ruhe gebettet.
Bohle, Hans-Joachim: "675 Jahre Bischofswerder" im
Heimat-Kurier, Heimatzeitung für den ehem. Kr. Rosenberg/Wpr. hrsg. v.
Karl-Heinz Damrow, Düsseldorf, Nov./Dez. 2000, S. 28.

12. Ausschnittvergrößerung
von Bild 11.
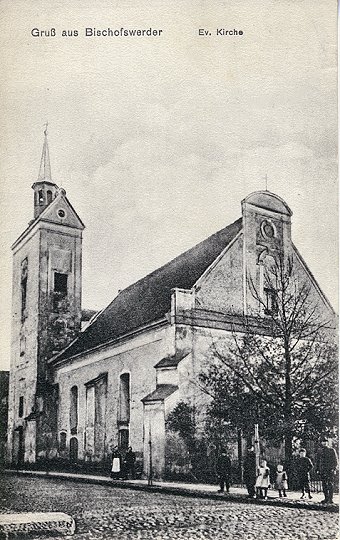
13. Die evangelische Stadtkirche (13.4.1908)
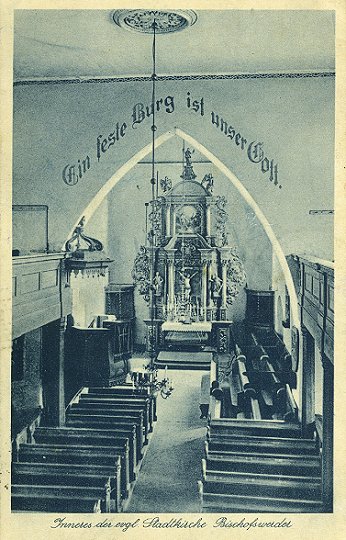
14. Innenaufnahme der ev. Stadtkirche
(1.8.1938) - Karte zur Erinnerung an die
600-Jahrfeier (1905)
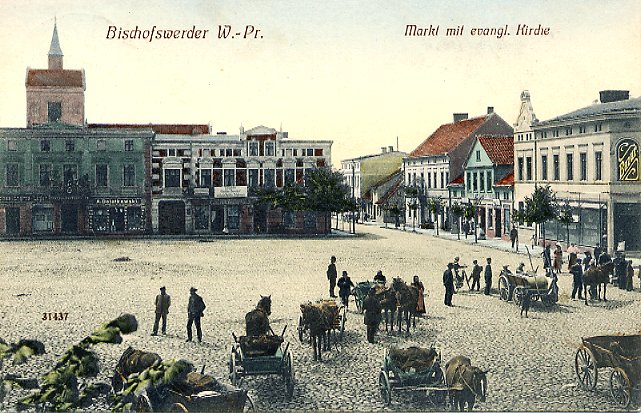
15. Bischofswerder - Markt mit evangelischer Kirche
(15.2.1912)
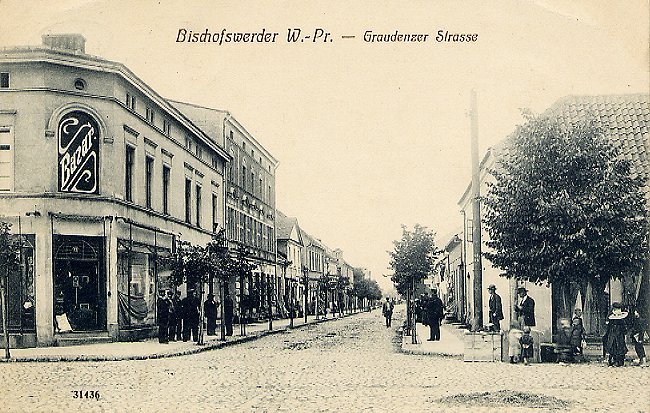
16. Graudenzer Straße in Bischofswerder
(1.3.1910)

17. Die Graudenzer Straße an derselben Stelle wie
oben (11.7.1920).
Im rechten Gebäude befanden sich die Kreissparkasse und
einige Geschäfte.
Teil 2
oder
Index
|